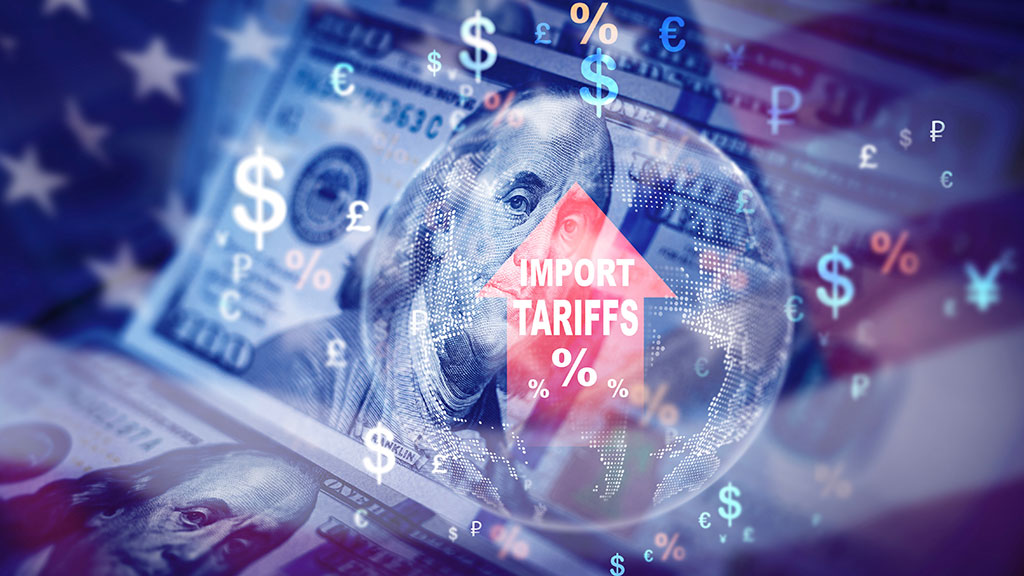
Anlage-Flash August 2025
Die US-Wirtschaft wächst laut Beige Book moderat, steht jedoch unter Druck durch Handelskonflikte und Arbeitsmarktrisiken. In Europa sollen Investitionen Impulse geben, während in der Schweiz das Wachstum gebremst ist.
Executive Summary
- Die US-Wirtschaft wächst gemäss Beige Book moderat. Herausforderungen am Arbeitsmarkt, der Handelskonflikt und die drohenden Zölle belasten.
- Deutschlands milliardenschwere Initiative «Made for Germany» und der EU-Haushaltsentwurf sollen Wachstumsimpulse liefern.
- In der Schweiz dämpft die zollbedingte Eintrübung die kurzfristige Entwicklung.
- Der Zinssenkungszyklus in der Schweiz und der Eurozone scheint zu Ende zu gehen. In den USA könnte die Fed dem politischen Druck auf Zinssenkungen trotz möglichem Inflationsdruck und potenziell steigender Verschuldung nachgeben.
Zollpolitik USA: historische Parallelen und aktuelle Entwicklung
- Zum Jahresende 2024 beliefen sich die von den USA erhobenen Zölle im Durchschnitt auf 2,3%.
- Mit Wirkung zum 1. August 2025 treten nun neue, unter der Trump-Administration ausgehandelte Zolltarife in Kraft. Diese bewegen sich für die meisten Handelspartner und Güter zwischen 15% und 50%. Die Mehrheit der Vereinbarungen dürften sich dabei am unteren Ende dieser Spanne bewegen – dennoch handelt es sich um einen massiven Anstieg. Dieser trägt auf der Einnahmenseite positiv zum Staatshaushalt bei, stellt jedoch faktisch eine versteckte Steuererhöhung dar, die vom Konsumenten getragen wird.
- Ein historischer Rückblick zeigt: Gegen Ende des 19. Jahrhunderts erhöhten die Republikaner unter Führung von William McKinley und Nelson Dingley die Zölle, um die heimische Industrie vor der preisgünstigen europäischen Konkurrenz zu schützen. Kurzfristig konnte ein gewisser Schutz der eigenen Industrie erreicht werden. Gleichzeitig führten
die erhöhten Importkosten zu einem Anstieg der Verbraucherpreise sowie zu einer zunehmenden wirtschaftlichen Abschottung und Handelskonflikten. - 1922 setzte der US-Präsident Warren G. Harding auf eine Hochzoll-Politik und führte die Fordney-McCumber-Zölle ein, denen 1930 die Smoot-Hawley-Zölle folgten. Auch andere Länder führten Gegenzölle ein, worauf der globale Handel drastisch einbrach. Die Massnahmen trugen wesentlich zur Verschärfung der Weltwirtschaftskrise bei.
- Trotz gewisser Parallelen erwarten die Finanzmärkte derzeit keine derartigen Auswirkungen der aktuellen Zollerhöhungen.
Historische durchschnittliche effektive US-Zollsätze (1900–2024)
Quelle: Bloomberg Finance L.P.
«Made for Germany» und Handelspolitik
- Das von der US-Notenbank veröffentliche Beige Book signalisiert insgesamt ein moderates Wachstum und damit eine leichte Erholung gegenüber der vorherigen Erhebung. Der Arbeitsmarkt zeigt wieder leichte Anzeichen einer Belebung, jedoch bleibt der Fachkräftemangel ein Problem. Die verschärften Abschiebungen reduzieren den Arbeiterpool zusätzlich. Unsicherheiten führen zu einer gewissen Zurückhaltung bei Neueinstellungen und belasten den Ausblick.
- In den USA wird für das zweite Quartal ein annualisiertes Wachstum von 3% ausgewiesen – nach einem leichten Rückgang um –0.2% im ersten. Wir rechnen weiterhin mit hohen Ausschlägen. Für das Jahr 2025 dürfte das Wirtschaftswachstum infolge der protektionistischen Massnahmen auf etwa 1,5% zurückgehen.
- In Deutschland lancieren führende Unternehmen eine Investitionsoffensive unter dem Titel «Made for Germany» in der Höhe von über 100 Mrd. EUR. Einschliesslich bereits zugesagter Mittel beläuft sich das Gesamtvolumen auf 631 Mrd. EUR. Die Umsetzung ist bis 2028 geplant und soll als privatwirtschaftliche Ergänzung der staatlichen Massnahmen für Infrastruktur, Rüstung und Energiewende verstanden werden. Die Initiative soll als positives Signal für den Standort Deutschland wirken und Impulse für ganz Europa liefern.
- Die EU-Kommission hat für den Zeitraum von 2028–2034 ein Haushaltsbudget von knapp 2’000 Mrd. EUR sowie einen zusätzlichen Krisenfonds von bis zu 400 Mrd. EUR beantragt. Die Finanzierung soll massgeblich durch eine Ausweitung der EU-Eigenmittel und durch neue Abgaben erfolgen. Über die Umsetzung entscheiden das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union. Widerstand wächst seitens der Nettozahler Deutschland und der Niederlande, dennoch scheint ein Konsens möglich. Die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe signalisieren eine Verbesserung der wirtschaftlichen Stimmung.
- In der Schweiz überraschte das Bruttoinlandprodukt im ersten Quartal mit einem Wachstum von 0,5% gegenüber dem Vorquartal sowie 2,0% auf Jahresbasis. Dieses starke Ergebnis ist im Wesentlichen auf vorgezogene Exporte in die USA zurückzuführen. Wir erwarten für 2025 eine Verlangsamung des Wachstums auf 1,2%. Insbesondere in der exportorientierten Industrie dürften sich die negativen Effekte der globalen Handelspolitik deutlicher bemerkbar machen, was sich im KOF-Konjunkturindikator bereits abgezeichnet haben könnte.
Einkaufsmanagerindizes Europa, verarbeitendes Gewerbe (3 Jahre)
Quelle: Bloomberg Finance L.P.
Schweiz: KOF-Konjunkturindikator vs. BIP und Einkaufsmanagerindex (30 Jahre)
Quelle: Bloomberg Finance L.P.
Notenbanken liefern wie erwartet
- Die SNB hat am 19. Juni ihren Leitzins auf 0% gesenkt und relativ klar signalisiert, Negativzinsen vermeiden zu wollen. Auch die Marktteilnehmer erwarten bis Ende Jahr keinen weiteren Zinsschnitt mehr. Und schliesslich notieren nur noch Staatsanleihen mit Laufzeiten bis drei Jahren mit negativen Renditen – noch vor einigen Wochen war dies für Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren der Fall.
- Die EZB senkte an ihrer Juni-Sitzung die Leitzinsen erneut je um 25 Basispunkte. Die Rendite des wichtigen Einlagesatzes liegt damit bei 2%. Christine Lagarde dämpft die Hoffnung auf weitere Schritte mit der Aussage, dass der Zinszyklus ausläuft. Bis Jahresende wird noch mit einer Zinssenkung gerechnet.
- Die Fed hat Ende 2024 ihren Leitzins in drei Schritten um einen Prozentpunkt gesenkt und seither unverändert belassen. Sie trägt damit ihrem Doppelmandat Rechnung. Arbeitsmarkt und Preisstabilität befinden sich bis dato auf Zielkurs, allerdings bedroht der Handelsstreit und die Zölle die Wachstumsaussichten und die Beschäftigungssituation. Als Folge der Einführung von Handelshemmnissen muss zudem mit einem einmaligen Inflationsschub gerechnet werden.
- Angesichts der hohen US-Verschuldung und dem enormen Refinanzierungsbedarf im laufenden Jahr forderte Donald Trump, die Zinsen zu senken und drohte den Fed-Präsidenten zu entlassen. Die Marktreaktion darauf manifestiert eine klare Missbilligung einer solchen Massnahme.
- Die aktuellen Daten (siehe Grafik) bieten durchaus Spielraum, dem Drängen nach tieferen Zinsen nachzugeben. Aus Vorsicht, eine robust laufende Wirtschaft übermässig zu befeuern und die Inflation zusätzlich anzuschieben, hält die Fed vorerst an ihrer zurückhaltenden Geldpolitik fest.
- Ein Nebenschauplatz mit weitreichenden Auswirkungen ist das jüngst in Kraft getretene Kryptogesetz, der «Genius Act». Das Gesetz erhielt auch breite Unterstützung vieler demokratischer Abgeordneter und fordert für sogenannte «Stablecoins», welche an den US-Dollar gekoppelt sind, eine 100%ige Mindestreserve in realen US-Dollar oder kurzlaufenden US-Staatsanleihen. Allerdings wird befürchtet, dass die Fed dadurch ihre Hoheit über die Geldschöpfung verlieren könnte.
- Die Auflösung des Yen-Carry-Trades – «The Great Unwind» – jährt sich Anfang August. Ausgelöst wurde die Bewegung damals durch die Abkehr der BOJ von der Nullzinspolitik und der Zinskurvenkontrolle. Seit Jahresbeginn sind die Renditen auf japanische Staatsanleihen am langen Ende deutlich um rund 0,8%-Punkte angestiegen, während das kurze Ende durch die Notenbank – im Vergleich zu einer Inflationsrate von 3,5% – auf tiefen 0,5% gehalten wird. Die steile Zinskurve dürfte sich bis Ende Jahr nur geringfügig abflachen.
Zinskurven Staatsanleihen vs. Konsumentenpreisinflation
Quelle: Bloomberg Finance L.P.
Japan: Veränderung der Zinskurve auf Staatsanleihen seit Anfang Jahr (in %)
Quelle: Bloomberg Finance L.P.
Anleihen: fordert der Markt bald höhere Renditen?
- Aktuell liegen die Renditen für 10-jährige Staatsanleihen in den USA bei 4,4%, in Deutschland bei 2,7% und in der Schweiz bei 0,4%. In Japan sind diese Sätze seit 2008 erstmals wieder auf über 1,6% gestiegen.
- Die verbalen Angriffe von Trump und Bessent auf Powell und die Fed haben zu einem Anstieg der Renditen am langen Ende geführt. Der politische Druck kann bis Ende Jahr zwei Zinssenkungen bewirken.
- Übergeordnet bleiben aber die Vorbehalte gegenüber den Auswirkungen der Massnahmen der Trump Administration bestehen: Steuerausfälle, steigende Staatsverschuldung, anziehende Inflation oder schwächere globale Wachstumsdynamik. Für diese Unsicherheit fordern die Investoren höhere Renditen.
- In Japan belastet die instabile politische Situation. Die liberale LDP-Koalition verliert nun auch die Mehrheit im Oberhaus und der Druck auf Ministerpräsident Ishiba steigt. Seit Monaten ziehen die Renditen am langen Ende an und dürften aufgrund des tiefen Anlegerinteresses bei Neuemissionen weiter anziehen. Angesichts der hohen Inflationsrate ergibt sich eine negative Realrendite von etwa –2,8 %, was kaum länger zu halten sein wird.
- Die Spreads auf Hochzins-, Unternehmens- und Schwellenländeranleihen haben sich weiter verengt und entschädigen kaum für das Risiko.
Zinsen 10-jährige Staatsanleihen in % (5 Jahre)
Quelle: Bloomberg Finance L.P.
Berichtssaison erfreulich gestartet
- Die Gewinnprognosen für das zweite Quartal wurden für den S&P 500 im Vorfeld von 12% auf 4% gesenkt, um nun deutlich übertroffen zu werden. Die Erwartungen für das laufende Quartal fielen unerwartet erfreulich aus. Der S&P 500 wie auch der Nasdaq eilen regelmässig zu neuen Rekordständen. Trotz anhaltender Unsicherheiten über die Zoll- und Handelspolitik bleiben die Konjunkturdaten solide. Schliesslich hat auch der schwache Dollar die Gewinnentwicklung der amerikanischen Unternehmen begünstigt.
- Die Frist am 1. August für die neu festgelegten Zölle könnte kurzfristig erneut für höhere Volatilität sorgen, was wir aber als Kaufgelegenheit einstufen.
- In Europa zeichnet sich in den Unternehmensergebnissen ein Trend zu einem schwächeren Umsatzwachstum ab. Preise konnten mehrheitlich weiter angehoben werden, hingegen belastet die mengenmässige Entwicklung. Darüber hinaus verursachen drohende Zölle auf EU-Importe zusätzlichen Margendruck bei exportorientierten Unternehmen.
- Allgemein befinden sich Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen auf rekordverdächtigem Niveau und bieten eine solide Kursunterstützung, was insbesondere auf Schweizer Aktien zutrifft.
Aktienmärkte: Performance seit 1.1.2025, indexiert, in Lokalwährung
Quelle: Bloomberg Finance L.P.
Sinkflug des Dollars unterbrochen
- Zum Schweizer Franken hat der Greenback in den letzten Monaten rund 14% verloren und konsolidiert nun bei rund 0,80. Technisch findet der Kurs auf diesem Niveau Unterstützung. Seit der Euro-Krise von 2011 und der Aufhebung der Kursbindung des Frankens an den Euro durch die SNB im Januar 2015 wurden diese Werte nicht mehr erreicht, was den Nimbus als sicherer Hafen und das Ausmass des Vertrauensverlustes in den Dollar widerspiegelt.
- Das Währungspaar EUR/CHF notiert seit Monaten in einer engen Spanne um die Marke von 0,94. Der Kurs ist durch ein Gleichgewicht aus politischer Unsicherheit in Europa und einer vorsichtigen geldpolitischen Haltung der SNB gestützt, relativ stabil.
- Die derzeitige Dollar-Schwäche zieht sich durch zahlreiche Währungspaare hindurch und steht vorab mit der veränderten, aggressiven Handelspolitik der USA im Zusammenhang. Diese Massnahmen führen zu einem erheblichen Vertrauensverlust, der durch die verbalen Angriffe auf die Unabhängigkeit der amerikanischen Notenbank noch verstärkt wird.
- Während kurzfristig eine technische Erholung im Dollar möglich scheint, wird die Dollar-Schwäche mittelfristig Bestand haben.
Euro und Dollar gegen Franken (1 Jahr)
Quelle: Bloomberg Finance L.P.
Zeitfenster für Gold-Konsolidierung läuft aus
- Der Goldkurs befindet sich erneut nahe den Höchstständen der letzten drei Monate. Ein Überschreiten dieser technisch wichtigen Widerstände eröffnet weiteres Aufwärtspotenzial bis 3’770 und möglicherweise 4’600 USD pro Unze.
- Haupttreiber sind nach wie vor die geopolitische und finanzielle Unsicherheit, die anhaltende Nachfrage von Zentralbanken v.a. aus BRICS+-Staaten, die Abkehr vom Dollar, die Angst vor einer anziehenden Inflation oder die global steigende Verschuldung.
- Während der Konsolidierungsphase im Gold erfreuten sich die weissen Edelmetalle, wie Silber, Platin und Palladium einer starken Nachfrage und sie konnten einen Teil ihrer relativen Unterperformance zum Gold abbauen, weisen aber weiteres Potenzial auf.
- Die hochvolatilen Erdölnotierungen sind aus den USA und durch die OPEC+ politisch beeinflusst. Nach der Beendigung der militärischen Intervention von Israel und den USA im Iran sind die Kurse wieder unter Druck, dies trotz ferienbedingt höherer Nachfrage.
- Die übrigen Rohstoffsektoren, wie Industriemetalle und Agrargüter, verzeichnen steigende Notierungen und tragen zu einem Kursanstieg im zusammengefassten Rohstoffindex bei.
Rohstoffindizes (12 Monate)
Quelle: Bloomberg Finance L.P.
Zollpolitik USA: historische Parallelen und aktuelle Entwicklung
- Zum Jahresende 2024 beliefen sich die von den USA erhobenen Zölle im Durchschnitt auf 2,3%.
- Mit Wirkung zum 1. August 2025 treten nun neue, unter der Trump-Administration ausgehandelte Zolltarife in Kraft. Diese bewegen sich für die meisten Handelspartner und Güter zwischen 15% und 50%. Die Mehrheit der Vereinbarungen dürften sich dabei am unteren Ende dieser Spanne bewegen – dennoch handelt es sich um einen massiven Anstieg. Dieser trägt auf der Einnahmenseite positiv zum Staatshaushalt bei, stellt jedoch faktisch eine versteckte Steuererhöhung dar, die vom Konsumenten getragen wird.
- Ein historischer Rückblick zeigt: Gegen Ende des 19. Jahrhunderts erhöhten die Republikaner unter Führung von William McKinley und Nelson Dingley die Zölle, um die heimische Industrie vor der preisgünstigen europäischen Konkurrenz zu schützen. Kurzfristig konnte ein gewisser Schutz der eigenen Industrie erreicht werden. Gleichzeitig führten
die erhöhten Importkosten zu einem Anstieg der Verbraucherpreise sowie zu einer zunehmenden wirtschaftlichen Abschottung und Handelskonflikten. - 1922 setzte der US-Präsident Warren G. Harding auf eine Hochzoll-Politik und führte die Fordney-McCumber-Zölle ein, denen 1930 die Smoot-Hawley-Zölle folgten. Auch andere Länder führten Gegenzölle ein, worauf der globale Handel drastisch einbrach. Die Massnahmen trugen wesentlich zur Verschärfung der Weltwirtschaftskrise bei.
- Trotz gewisser Parallelen erwarten die Finanzmärkte derzeit keine derartigen Auswirkungen der aktuellen Zollerhöhungen.
Historische durchschnittliche effektive US-Zollsätze (1900–2024)
Quelle: Bloomberg Finance L.P.
«Made for Germany» und Handelspolitik
- Das von der US-Notenbank veröffentliche Beige Book signalisiert insgesamt ein moderates Wachstum und damit eine leichte Erholung gegenüber der vorherigen Erhebung. Der Arbeitsmarkt zeigt wieder leichte Anzeichen einer Belebung, jedoch bleibt der Fachkräftemangel ein Problem. Die verschärften Abschiebungen reduzieren den Arbeiterpool zusätzlich. Unsicherheiten führen zu einer gewissen Zurückhaltung bei Neueinstellungen und belasten den Ausblick.
- In den USA wird für das zweite Quartal ein annualisiertes Wachstum von 3% ausgewiesen – nach einem leichten Rückgang um –0.2% im ersten. Wir rechnen weiterhin mit hohen Ausschlägen. Für das Jahr 2025 dürfte das Wirtschaftswachstum infolge der protektionistischen Massnahmen auf etwa 1,5% zurückgehen.
- In Deutschland lancieren führende Unternehmen eine Investitionsoffensive unter dem Titel «Made for Germany» in der Höhe von über 100 Mrd. EUR. Einschliesslich bereits zugesagter Mittel beläuft sich das Gesamtvolumen auf 631 Mrd. EUR. Die Umsetzung ist bis 2028 geplant und soll als privatwirtschaftliche Ergänzung der staatlichen Massnahmen für Infrastruktur, Rüstung und Energiewende verstanden werden. Die Initiative soll als positives Signal für den Standort Deutschland wirken und Impulse für ganz Europa liefern.
- Die EU-Kommission hat für den Zeitraum von 2028–2034 ein Haushaltsbudget von knapp 2’000 Mrd. EUR sowie einen zusätzlichen Krisenfonds von bis zu 400 Mrd. EUR beantragt. Die Finanzierung soll massgeblich durch eine Ausweitung der EU-Eigenmittel und durch neue Abgaben erfolgen. Über die Umsetzung entscheiden das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union. Widerstand wächst seitens der Nettozahler Deutschland und der Niederlande, dennoch scheint ein Konsens möglich. Die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe signalisieren eine Verbesserung der wirtschaftlichen Stimmung.
- In der Schweiz überraschte das Bruttoinlandprodukt im ersten Quartal mit einem Wachstum von 0,5% gegenüber dem Vorquartal sowie 2,0% auf Jahresbasis. Dieses starke Ergebnis ist im Wesentlichen auf vorgezogene Exporte in die USA zurückzuführen. Wir erwarten für 2025 eine Verlangsamung des Wachstums auf 1,2%. Insbesondere in der exportorientierten Industrie dürften sich die negativen Effekte der globalen Handelspolitik deutlicher bemerkbar machen, was sich im KOF-Konjunkturindikator bereits abgezeichnet haben könnte.
Einkaufsmanagerindizes Europa, verarbeitendes Gewerbe (3 Jahre)
Quelle: Bloomberg Finance L.P.
Schweiz: KOF-Konjunkturindikator vs. BIP und Einkaufsmanagerindex (30 Jahre)
Quelle: Bloomberg Finance L.P.
Notenbanken liefern wie erwartet
- Die SNB hat am 19. Juni ihren Leitzins auf 0% gesenkt und relativ klar signalisiert, Negativzinsen vermeiden zu wollen. Auch die Marktteilnehmer erwarten bis Ende Jahr keinen weiteren Zinsschnitt mehr. Und schliesslich notieren nur noch Staatsanleihen mit Laufzeiten bis drei Jahren mit negativen Renditen – noch vor einigen Wochen war dies für Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren der Fall.
- Die EZB senkte an ihrer Juni-Sitzung die Leitzinsen erneut je um 25 Basispunkte. Die Rendite des wichtigen Einlagesatzes liegt damit bei 2%. Christine Lagarde dämpft die Hoffnung auf weitere Schritte mit der Aussage, dass der Zinszyklus ausläuft. Bis Jahresende wird noch mit einer Zinssenkung gerechnet.
- Die Fed hat Ende 2024 ihren Leitzins in drei Schritten um einen Prozentpunkt gesenkt und seither unverändert belassen. Sie trägt damit ihrem Doppelmandat Rechnung. Arbeitsmarkt und Preisstabilität befinden sich bis dato auf Zielkurs, allerdings bedroht der Handelsstreit und die Zölle die Wachstumsaussichten und die Beschäftigungssituation. Als Folge der Einführung von Handelshemmnissen muss zudem mit einem einmaligen Inflationsschub gerechnet werden.
- Angesichts der hohen US-Verschuldung und dem enormen Refinanzierungsbedarf im laufenden Jahr forderte Donald Trump, die Zinsen zu senken und drohte den Fed-Präsidenten zu entlassen. Die Marktreaktion darauf manifestiert eine klare Missbilligung einer solchen Massnahme.
- Die aktuellen Daten (siehe Grafik) bieten durchaus Spielraum, dem Drängen nach tieferen Zinsen nachzugeben. Aus Vorsicht, eine robust laufende Wirtschaft übermässig zu befeuern und die Inflation zusätzlich anzuschieben, hält die Fed vorerst an ihrer zurückhaltenden Geldpolitik fest.
- Ein Nebenschauplatz mit weitreichenden Auswirkungen ist das jüngst in Kraft getretene Kryptogesetz, der «Genius Act». Das Gesetz erhielt auch breite Unterstützung vieler demokratischer Abgeordneter und fordert für sogenannte «Stablecoins», welche an den US-Dollar gekoppelt sind, eine 100%ige Mindestreserve in realen US-Dollar oder kurzlaufenden US-Staatsanleihen. Allerdings wird befürchtet, dass die Fed dadurch ihre Hoheit über die Geldschöpfung verlieren könnte.
- Die Auflösung des Yen-Carry-Trades – «The Great Unwind» – jährt sich Anfang August. Ausgelöst wurde die Bewegung damals durch die Abkehr der BOJ von der Nullzinspolitik und der Zinskurvenkontrolle. Seit Jahresbeginn sind die Renditen auf japanische Staatsanleihen am langen Ende deutlich um rund 0,8%-Punkte angestiegen, während das kurze Ende durch die Notenbank – im Vergleich zu einer Inflationsrate von 3,5% – auf tiefen 0,5% gehalten wird. Die steile Zinskurve dürfte sich bis Ende Jahr nur geringfügig abflachen.
Zinskurven Staatsanleihen vs. Konsumentenpreisinflation
Quelle: Bloomberg Finance L.P.
Japan: Veränderung der Zinskurve auf Staatsanleihen seit Anfang Jahr (in %)
Quelle: Bloomberg Finance L.P.
Anleihen: fordert der Markt bald höhere Renditen?
- Aktuell liegen die Renditen für 10-jährige Staatsanleihen in den USA bei 4,4%, in Deutschland bei 2,7% und in der Schweiz bei 0,4%. In Japan sind diese Sätze seit 2008 erstmals wieder auf über 1,6% gestiegen.
- Die verbalen Angriffe von Trump und Bessent auf Powell und die Fed haben zu einem Anstieg der Renditen am langen Ende geführt. Der politische Druck kann bis Ende Jahr zwei Zinssenkungen bewirken.
- Übergeordnet bleiben aber die Vorbehalte gegenüber den Auswirkungen der Massnahmen der Trump Administration bestehen: Steuerausfälle, steigende Staatsverschuldung, anziehende Inflation oder schwächere globale Wachstumsdynamik. Für diese Unsicherheit fordern die Investoren höhere Renditen.
- In Japan belastet die instabile politische Situation. Die liberale LDP-Koalition verliert nun auch die Mehrheit im Oberhaus und der Druck auf Ministerpräsident Ishiba steigt. Seit Monaten ziehen die Renditen am langen Ende an und dürften aufgrund des tiefen Anlegerinteresses bei Neuemissionen weiter anziehen. Angesichts der hohen Inflationsrate ergibt sich eine negative Realrendite von etwa –2,8 %, was kaum länger zu halten sein wird.
- Die Spreads auf Hochzins-, Unternehmens- und Schwellenländeranleihen haben sich weiter verengt und entschädigen kaum für das Risiko.
Zinsen 10-jährige Staatsanleihen in % (5 Jahre)
Quelle: Bloomberg Finance L.P.
Berichtssaison erfreulich gestartet
- Die Gewinnprognosen für das zweite Quartal wurden für den S&P 500 im Vorfeld von 12% auf 4% gesenkt, um nun deutlich übertroffen zu werden. Die Erwartungen für das laufende Quartal fielen unerwartet erfreulich aus. Der S&P 500 wie auch der Nasdaq eilen regelmässig zu neuen Rekordständen. Trotz anhaltender Unsicherheiten über die Zoll- und Handelspolitik bleiben die Konjunkturdaten solide. Schliesslich hat auch der schwache Dollar die Gewinnentwicklung der amerikanischen Unternehmen begünstigt.
- Die Frist am 1. August für die neu festgelegten Zölle könnte kurzfristig erneut für höhere Volatilität sorgen, was wir aber als Kaufgelegenheit einstufen.
- In Europa zeichnet sich in den Unternehmensergebnissen ein Trend zu einem schwächeren Umsatzwachstum ab. Preise konnten mehrheitlich weiter angehoben werden, hingegen belastet die mengenmässige Entwicklung. Darüber hinaus verursachen drohende Zölle auf EU-Importe zusätzlichen Margendruck bei exportorientierten Unternehmen.
- Allgemein befinden sich Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen auf rekordverdächtigem Niveau und bieten eine solide Kursunterstützung, was insbesondere auf Schweizer Aktien zutrifft.
Aktienmärkte: Performance seit 1.1.2025, indexiert, in Lokalwährung
Quelle: Bloomberg Finance L.P.
Sinkflug des Dollars unterbrochen
- Zum Schweizer Franken hat der Greenback in den letzten Monaten rund 14% verloren und konsolidiert nun bei rund 0,80. Technisch findet der Kurs auf diesem Niveau Unterstützung. Seit der Euro-Krise von 2011 und der Aufhebung der Kursbindung des Frankens an den Euro durch die SNB im Januar 2015 wurden diese Werte nicht mehr erreicht, was den Nimbus als sicherer Hafen und das Ausmass des Vertrauensverlustes in den Dollar widerspiegelt.
- Das Währungspaar EUR/CHF notiert seit Monaten in einer engen Spanne um die Marke von 0,94. Der Kurs ist durch ein Gleichgewicht aus politischer Unsicherheit in Europa und einer vorsichtigen geldpolitischen Haltung der SNB gestützt, relativ stabil.
- Die derzeitige Dollar-Schwäche zieht sich durch zahlreiche Währungspaare hindurch und steht vorab mit der veränderten, aggressiven Handelspolitik der USA im Zusammenhang. Diese Massnahmen führen zu einem erheblichen Vertrauensverlust, der durch die verbalen Angriffe auf die Unabhängigkeit der amerikanischen Notenbank noch verstärkt wird.
- Während kurzfristig eine technische Erholung im Dollar möglich scheint, wird die Dollar-Schwäche mittelfristig Bestand haben.
Euro und Dollar gegen Franken (1 Jahr)
Quelle: Bloomberg Finance L.P.
Zeitfenster für Gold-Konsolidierung läuft aus
- Der Goldkurs befindet sich erneut nahe den Höchstständen der letzten drei Monate. Ein Überschreiten dieser technisch wichtigen Widerstände eröffnet weiteres Aufwärtspotenzial bis 3’770 und möglicherweise 4’600 USD pro Unze.
- Haupttreiber sind nach wie vor die geopolitische und finanzielle Unsicherheit, die anhaltende Nachfrage von Zentralbanken v.a. aus BRICS+-Staaten, die Abkehr vom Dollar, die Angst vor einer anziehenden Inflation oder die global steigende Verschuldung.
- Während der Konsolidierungsphase im Gold erfreuten sich die weissen Edelmetalle, wie Silber, Platin und Palladium einer starken Nachfrage und sie konnten einen Teil ihrer relativen Unterperformance zum Gold abbauen, weisen aber weiteres Potenzial auf.
- Die hochvolatilen Erdölnotierungen sind aus den USA und durch die OPEC+ politisch beeinflusst. Nach der Beendigung der militärischen Intervention von Israel und den USA im Iran sind die Kurse wieder unter Druck, dies trotz ferienbedingt höherer Nachfrage.
- Die übrigen Rohstoffsektoren, wie Industriemetalle und Agrargüter, verzeichnen steigende Notierungen und tragen zu einem Kursanstieg im zusammengefassten Rohstoffindex bei.
Rohstoffindizes (12 Monate)
Quelle: Bloomberg Finance L.P.
Downloads
Dieses Dokument dient ausschliesslich zur Information. Es ist weder Angebot noch Aufforderung für den Kauf oder Verkauf von Produkten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen. Die Publikation entstand in Kooperation mit Aquila.